Bei „Aus dem Pflaster-Laster“ berichte ich von Einsätzen, dem Alltag auf der Rettungswache und von aktuellen Themen – von purer Routine bis zum Drama. Am Ende ziehe ich mein Fazit der Einsätze und zeige auf, was gut lief und was besser laufen könnte. Namen von Patienten, Orten und Kollegen lasse ich selbstverständlich aus.
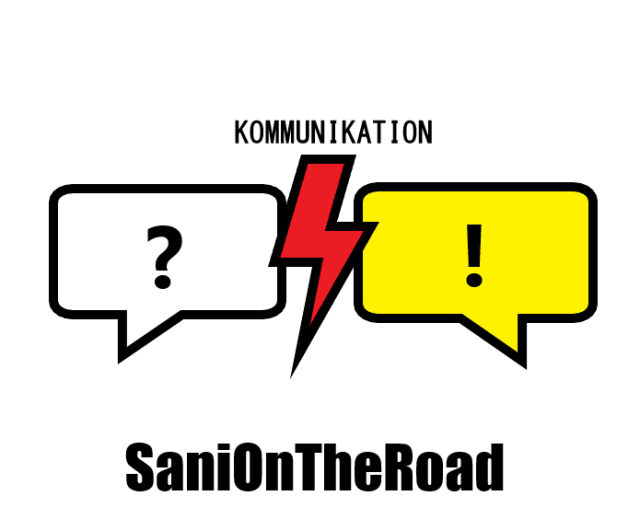
Die unterschätzte Komponente der Professionalität
Die Geschichte, die ich euch präsentiere, hat sich während meiner Notfallsanitäter-Ausbildung in der Anästhesie abgespielt – und auch nach einiger Zeit, die seitdem vergangen ist, ist sie mir noch gut in Erinnerung.
Das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich sie ganz gerne den neuen Auszubildenden (oder auch den Rettungssanitätern) erzähle, wenn sie auf dieses Thema – in welcher Form auch immer – zu sprechen kommen.
Oder es liegt daran, dass ich sie den „Altassistenten“ erzählt habe, die sich bei der Vorbereitung auf die Ergänzungsprüfung köstlich über das Thema aufgeregt haben und es mit den Worten „Brauch ich nicht“ abgetan haben.
Auch wenn sich das alles in der Klinik abgespielt hat, kann und tut das Grundproblem in gleicher (und ähnlicher) Form auch im Rettungsdienst auftreten. Tagtäglich. Und das ist offen gesagt ein Problem.
Es war einmal…
…im zweiten Lehrjahr meiner NFS-Ausbildung. Ich hatte meinen zweiten Anästhesieblock und war die meiste Zeit einem Pfleger zugeteilt. So weit, so gut.
Der Pfleger war mit Anfang 60 zweifellos einer der Dienstältesten in der Abteilung, knappe 1,90 m groß, kräftig gebaut und mit grau-weißem Vollbart ausgestattet – ein richtiger „Bär“, den man die Bundeswehrzeit noch anmerkte.
Fachlich konnte ihm so schnell niemand etwas vormachen – für alles, was er tat, konnte er mir ohne große Überlegungen auch eine plausible Begründung liefern, warum. Dessen war er sich auch durchaus bewusst. Selbst wenn es Probleme gab, reagierte er souverän und mit einer beinahe stoischen Ruhe.
Erfahrungstechnisch waren die älteren Oberärzte eigentlich die einzigen, die ihm das Wasser reichen konnten. Eigentlich kein Unsympath und kein schlechter Anleiter.
Und dennoch: wahrscheinlich wurden wenige andere als so unprofessionell wahrgenommen, wie er.
Warum?
„Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Von der Lunge auf die Zunge.“
Das hatte er mir schon bei der ersten Zusammenarbeit gesagt. Und ja, es war nicht nur ein Spruch – es schien in gewisser Weise sein Lebensmotto zu sein.
Er war ein geradliniger, direkter Mensch. Sehr direkt. So direkt, dass jeglicher Gedanke in vollkommener Ignoranz der Situation sofort und ungefiltert zu Tage trat.
Und das war ein Problem.
Einmal kam eine junge, gerade volljährige Patientin vollkommen aufgelöst zu uns in den OP. Sie hatte furchtbare Angst vor der Narkose und der Operation.
Während die Anästhesisten versuchte, sie zu beruhigen und ich das Monitoring anschloss, kam von seiner Seite ein
„Stell dich nicht so an, man kann’s auch übertreiben.“
– was weder zur Beruhigung der Patientin, noch – wie von ihm angedacht – zur Auflockerung der Situation beigetragen hatte. Es gab eine kurze Ansage der Anästhesistin und damit war das Thema vorerst einmal abgehakt.
An der Stelle frage ich meinen Gesprächspartner liebend gerne, wie sie das Verhalten beurteilen.
Wie hättest Du dich gefühlt, wärst Du an der Stelle des Mädchens gewesen? Wie würdest Du dich fühlen, wenn man deine Ängste und Sorgen nicht ernst nimmt? Was glaubst Du, wie die Pflege und das Klinikum ihr wohl in Erinnerung bleiben?
Eine andere Situation ergab sich bei einem „OP-Erfahrenen“, mit Mitte 50 noch „jüngeren“ Patienten, bei dem eine Revision der Knie-TEP anstand.
Der gute Mann hatte ziemlich lange Probleme, war die letzten Tage immobil im Krankenhaus und musste miterleben, wie die OP zweimal angesetzt und verschoben wurde – einmal davon, wo er schon in der Einleitung war.
Dementsprechend „gedrückt“ war die Laune des Mannes, der nun über’s Wochenende auf Versuch Nummer 3 gewartet hat. Trotz Kenntnis der Vorgeschichte gab es von Seiten des Pflegers ein
„So dramatisch ist es ja nicht, sie haben es ja bis heute überlebt.“
Der Patient hat diese spontane Äußerung allerdings in den falschen Hals bekommen. Sehr sogar. Die darauffolgende Diskussion wurde recht schnell laut und erst dann gelöst, nachdem sich Oberarzt, Patient und Stationsleitung der Anästhesie auf einen „Teamtausch“ geeinigt hatten.
Auch hier stelle ich gerne Fragen.
Wie hättest Du dich gefühlt, wenn man dein Leid trotz Verschulden der Organisation nicht ernst nimmt? Würdest Du das Verhalten als professionell bezeichnen? Mit welchen Gefühl würdest Du die Klinik verlassen?
Das Verhalten zu den Patienten ist das eine – das zu den Kollegen, insbesondere der ärztlichen Seite, noch einmal etwas anderes.
„Ich habe Scheiße abwischen gelernt, und für euch wisch ich die ganze Scheiße ab.“
oder
„Ich hab ja nicht studiert, was weiß ich schon?“
waren weitere Aussagen, die er quasi als Lebensmotto gewählt hatte.
Die Ärzteschaft sah er – ganz offensichtlich – zu einem großen Teil als Feindbild. Ob es aus negativen Erfahrungen oder einer falschen Erwartungshaltung oder aus sonstigen Gründen herrührte, vermag ich nicht zu beurteilen.
Jedenfalls bekamen die Ärzte, unabhängig von Rang und Erfahrung, regelmäßig ihr Fett weg. Und zwar direkt und ungefiltert.
Selbst ein noch so kleiner Fehler des unerfahrenen Assistenzarztes wurde, gerne in Kombination mit einem Spruch oder in einer herablassenden Tonlage, klar und deutlich kommuniziert. Ob wir einen Patienten hatten oder nicht – egal. Ob der Patient wach und orientiert war und alles mitbekam – egal.
Dass er sich bei den Assistenzärzten einen teilweise „gefürchteten“ Ruf aufgebaut hatte, ist nicht verwunderlich.
Bei den Oberärzten gab es regelmäßig Kontra – was allein in den vier Wochen zu mehrfachen Gesprächen hinter geschlossener Tür geführt hat.
Eigentlich sind es die letzten Fragen, die ich in dem Zusammenhang stelle.
Wie bewertet ihr den Umgang mit Kollegen und Ärzten? Wie findet ihr den Umgang mit Fehlern – und warum? Wie würdet ihr den Pfleger einschätzen – professionell oder unprofessionell?
Der ungewollt große Einfluss
Die meisten kommen nach der Geschichte zu dem Ergebnis „unprofessionell“. Was noch viel erstaunlicher ist: von der Arbeit, dem fachlichen Können, habe ich sehr wenig erwähnt – denn das war schlicht einwandfrei.
Und dennoch kommt man fast schon instinktiv zum Ergebnis „unprofessionell“.
Genau deshalb finde ich diese Geschichte so genial für das Thema Kommunikation – die Wahrnehmung, das was als Eindruck hängen bleibt, hängt maßgeblich von ihr ab.
Es spiegelt zu einem großen Teil die Wahrnehmung von Dritten und insbesondere der Patienten wieder – und diese Eindrücke bleiben hängen. Positiv oder negativ.
Die reibungslose Zusammenarbeit, das gute Miteinander – dass werden die meisten auch anders sehen, als hier der Umgang mit der Belegschaft gezeigt wurde. Offen ausgetragene Konflikte und Meinungsverschiedenheiten, die die Arbeit vor allem eins machen: unangenehm.
Ein unangenehmes Arbeitsumfeld führt zwangsläufig zu schlechteren Arbeitsergebnissen. Ob der Assistenzarzt vielleicht eher versucht, einen Fehler zu vertuschen, statt einen „Einlauf“ zu bekommen? Möglich. Ob dadurch vielleicht Patienten geschädigt werden? Möglich.
Fazit
Die Kommunikation hat einen unheimlich großen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir wahrgenommen werden. Von unseren Kollegen – und, beinahe noch wichtiger – von unseren Patienten.
Eine situations– und patientengerechte, adäquate Kommunikation trägt unglaublich viel zu einem professionellen Auftreten (und einer entsprechenden Wahrnehmung der Außenwelt) bei – mehr, als es die beste, leitliniengerechte Arbeit tut.
Gleichermaßen wirft eine schlechte Kommunikation unweigerlich ein schlechtes Bild auf den Mitarbeiter und im weiteren auf den gesamten Rettungsdienst.
Kommunikation ist mehr, als man in der Abschlussprüfung an Modellen erläutert. Schulz von Thun, Hall und Watzlawick lösen vielleicht keine Einsätze – die dahinterstehenden Überlegungen können (und tun) aber erheblich dazu beitragen, wenn man diese Ressourcen kennt. Und nutzt.
Beispiele wie die oben genannten gibt es auch im Rettungsdienst – und das gar nicht mal so selten. Ich behaupte, dass die meisten negativen Wahrnehmungen in Bezug auf den Rettungsdienst „schlechte“ Kommunikation als Ursache haben. So viel zur Bedeutung dieses „weichen Fachs“.
Professionalität hört nicht bei fachlich korrekter Notfallmedizin auf – sie beginnt dort, und zieht sich über viele weitere Gebiete, die oft gar nicht oder nur am Rande beachtet werden. Gute Kommunikation bedeutet auch in einer Notfallsituation für den Patienten Sicherheit und vor allem: Menschlichkeit.
Dass es darauf nicht selten mehr ankommt, als auch maximal invasive Maßnahmen, muss manchmal aktiv wieder ins Bewusstsein gerufen werden. Ebenso auch die Notwendigkeit, unsere eigenes Kommunikationsverhalten immer wieder kritisch zu hinterfragen.
Background-Info
Schulz von Thun
Entwickler des Konzepts „Vier Seiten einer Nachricht“ – Grundaussage: jede Nachricht hat vier Seiten, sowohl beim Sprechen/Mitteilen, als auch beim Empfang einer Nachricht. Schlussfolgerung: das Wahrgenommene muss nicht dem entsprechen, was der Sender gemeint hat.
Hall
Hat die Distanzzonen und ihre Bedeutung herausgearbeitet.
Watzlawick
Begründer der Aussage „Man kann nicht nicht kommunizieren“ – große Bedeutung insbesondere im Kontext mit unwillkürlicher, nonverbaler Kommunikation mittels Mimik und Gestik.
Folgt meinem Blog!
Du möchtest nichts mehr verpassen? Neuigkeiten von mir gibt es auch per Mail!
Es gelten unsere Datenschutz– und Nutzungsbestimmungen.
Eine gewisse Direktheit finde ich gelegentlich erfrischend und je nach Situation angebracht, aber der Kommunikationsstil jenes Pflegers geht ja mal gar nicht. … Das ist ja mehr so der „Elefant im Porzellanladen“. 😉
Als Patient habe ich solche „Besen“ im Krankenhaus zum Glück zwar nicht erlebt, dafür andere Situationen, in denen ich mich ehrlich gefragt habe, wo ich hier eigentlich gelandet bin und an der psychisch-kognitiven Gesundheit zweier Pflegerinnen gezweifelt habe. Leider muss man damit als Patient leben, man ist ja auf deren Hilfe und Wohlwollen angewiesen und ich hätte keine Lust gehabt, dass die mich anschließend auf dem Kieker gehabt hätten. Aber ja, das hat den ansonsten positiven Eindruck getrübt bzw. stehen diese negativen Eindrücke eben neben den neutralen und positiven Erlebnissen.
Wirklich nachhaltig schlimm und beunruhigend finde ich nur, was meiner Mutter bei ihrem Notruf für meinen Vater passiert ist. Mein Vater – multimorbid und u.a. nach einer Herz-OP frisch entlassen – hatte nachts plötzlich akute Atemnot, blaue Lippen und Brustschmerzen. Er ist absolut nicht der Mensch, der sich unnötig anstellt.
Meine Mutter hat trotz der Situation Ruhe bewahrt und alles sachlich geschildert, so wie man das ja eigentlich machen soll.
Sie musste sich dann anhören, dass es ja nicht so schlimm mit meinem Vater sein könne, wenn sie als Ehefrau alles recht ruhig und geordnet schildern könnte (O-Ton).
Nur weil sie hartnäckig geblieben ist und sich von den weiteren ähnlichen Kommentaren des Disponenten nicht hat abwimmeln lassen, wurde äußerst widerwillig immerhin doch ein RTW geschickt, dessen Besatzung dann eben den Notarzt nachgefordert hat. … Alles in einer ziemlich ländlichen Gegend, mit entsprechend viel Zeitverzug. (Mein Vater ist dann ins Krankenhaus eingeliefert worden und hat alles letztlich heil überstanden, sonst würde ich darüber möglicherweise anders schreiben.)
Dass die Situation für den Disponenten schwierig einzuschätzen ist und der die Mittel sorgfältig „verwalten“ muss, ist mir klar und ich habe Verständnis dafür, dass man nicht ad hoc aus der Ferne alles richtig einschätzen kann. Aber die wortwörtliche Begründung, dass meine Mutter böse gesagt nicht panisch genug geklungen habe, und ihr Anruf deshalb nicht ernst genommen worden ist, finde ich schon übel.
Selbst meine Mutter, die recht gestanden ist, hat dieses Erlebnis nachhaltig verunsichert, weil ihr die Sachlichkeit/gefasste Art ja gerade negativ ausgelegt worden ist, obwohl es immer heißt, dass man im Notfall Ruhe bewahren solle.
Auch bei Notanrufen bei der Polizei:
https://www.welt.de/regionales/bayern/article162118306/Polizist-schickt-trotz-Notrufs-keine-Streife-6000-Euro-Strafe.html
„Als Grund dafür, dass er dem späteren Opfer nicht die erwünschte Hilfe schickte, gab er dessen ruhigen, sachlichen Ton bei dem Notruf an.“
Sorry, in diesem Artikel steht das mit dem „zu sachlichen Tonfall“:
https://www.derwesten.de/panorama/junge-verpruegelt-weil-polizist-den-notruf-nicht-ernst-nahm-id209629963.html
Sicher, eine gewisse Direktheit kann auch als positiv empfunden werden – kommt ganz auf den Kommunikationskontext an 😉
Und da braucht es tatsächlich immer etwas „Fingerspitzengefühl“ – das hat besagter Pfleger einfach nicht besessen. Fairerweise muss man auch sagen: Kommunikation hatte er nie „gelernt“, im Sinne eines Ausbildungsfachs.
Ich finde es grundsätzlich bedauerlich, wenn die Erfahrungen mit der Leitstelle negativ sind – das schafft im Verlauf sehr große Probleme, durchaus auch bis zu der Verweigerung des Notrufs bei zukünftigen Notfällen.
Der Leitstellendisponent hat medizinisch wohl falsch eingeschätzt, kommunikationstechnisch hat er sich allerdings selbst einen Bärendienst erwiesen. Das offene Anzweifeln des Anrufers ist, außer bei offensichtlichen Spaßanrufen, ebenfalls unprofessionell.
Der Leitstellendisponent hat im gesamten Konstrukt der präklinischen Notfallmedizin einfach eine denkbar ungünstige Position. Er ist der Böse, wenn dem Wunsch des Anrufers nicht entsprochen wird. Er ist der Böse, wenn der Rettungsdienst wegen „Kappes“ rausalarmiert wird
Und dafür darf er noch 40, 50 mal am Tag neu entscheiden, was kritisch ist und was nicht. Wer Hilfe braucht und wer nicht. Wer welche Hilfe bekommt. Dafür gibt’s einen Zeitansatz von 60 – 90 Sekunden.
Eine absolute Fehlerfreiheit ist zwar erstrebenswert, aber leider unrealistisch. Das Problem der „subjektiven Fehleinschätzung“, wie es in dem Fall deines Vaters vorlag, lässt sich mit konsequenter Umsetzung standardisierter Abfrageschemata allerdings in den Griff kriegen.
Allerdings: auch diese sind nicht fehlerfrei.
Eine sehr schöne Darstellung, wie eine standardisierte Notrufabfrage aussehen kann, liefert die Berufsrettung Wien: https://www.youtube.com/watch?v=7o9MMtWvBLU&t=2134s ab 12:16
Danke für den Link. 🙂
Zu beneiden ist der Leitstellendisponent wahrlich nicht und ich habe auch sehr viel Verständnis dafür, dass er einen schwierigen, stressigen Job hat und es dabei zu Fehleinschätzungen kommen kann. Zumal er zur Einschätzung der Lage ja nur die Schilderung des Anrufers hat.
Irritierend war im Fall meines Vaters wíe gesagt die Begründung, warum er den Anruf als „nicht ernst“ eingeschätzt hat. Wenn er es dagegen an den beschriebenen Symptomen festgemacht hätte, wäre das etwas anderes gewesen.
Andererseits denke ich, dass die meisten Leitstellendisponenten meistens einen guten Job machen.
Gerne!